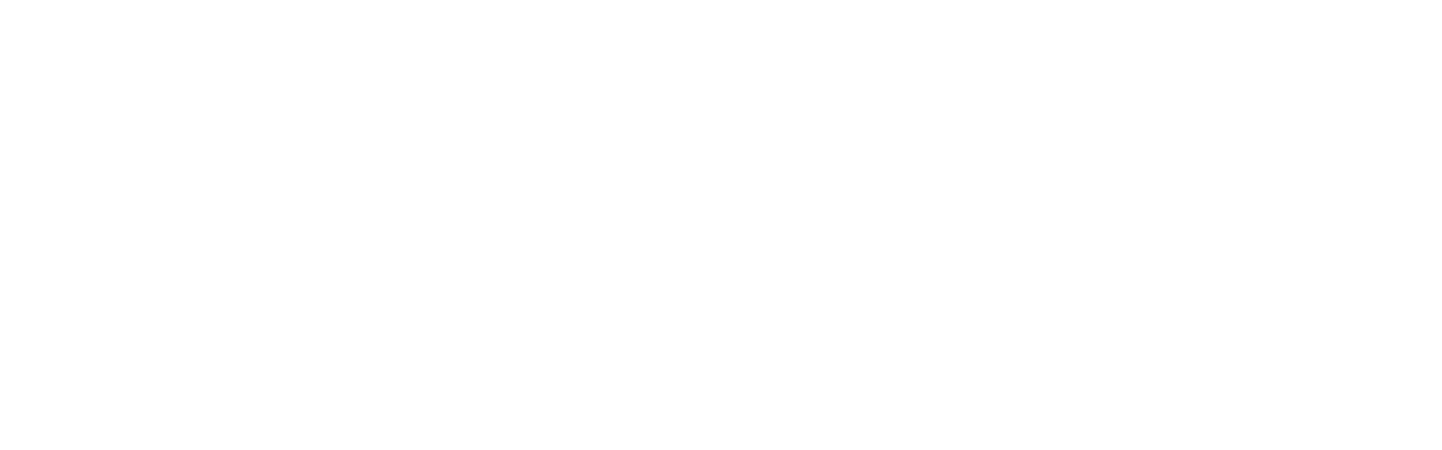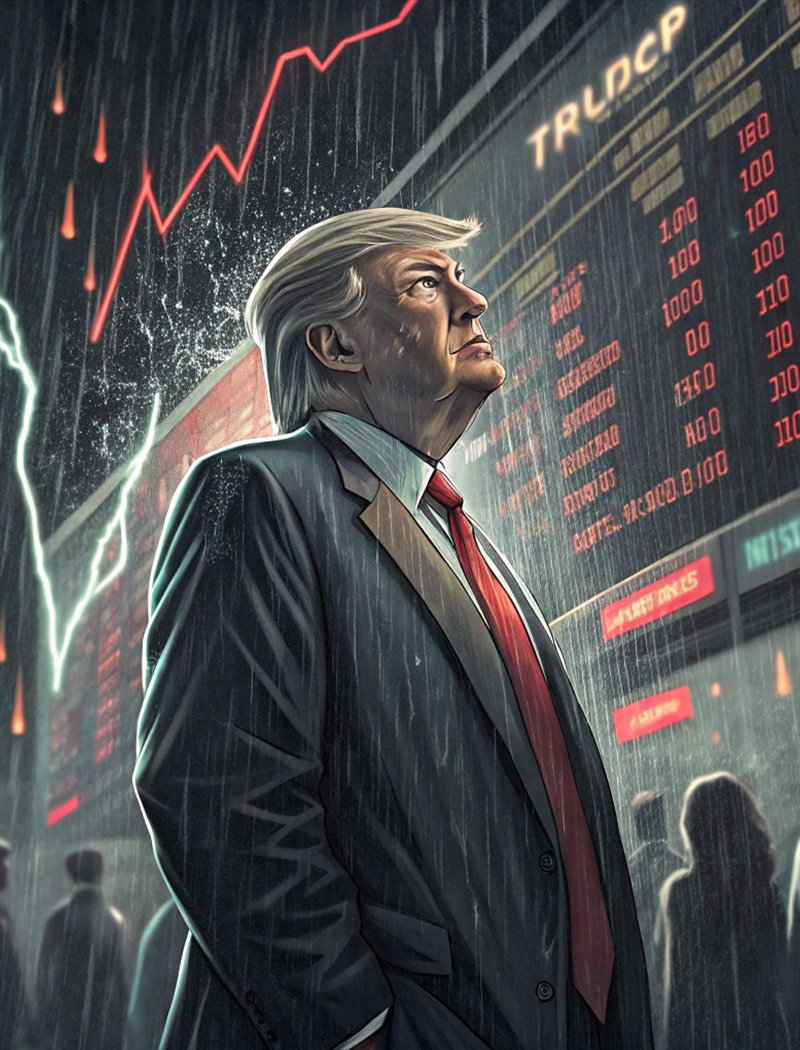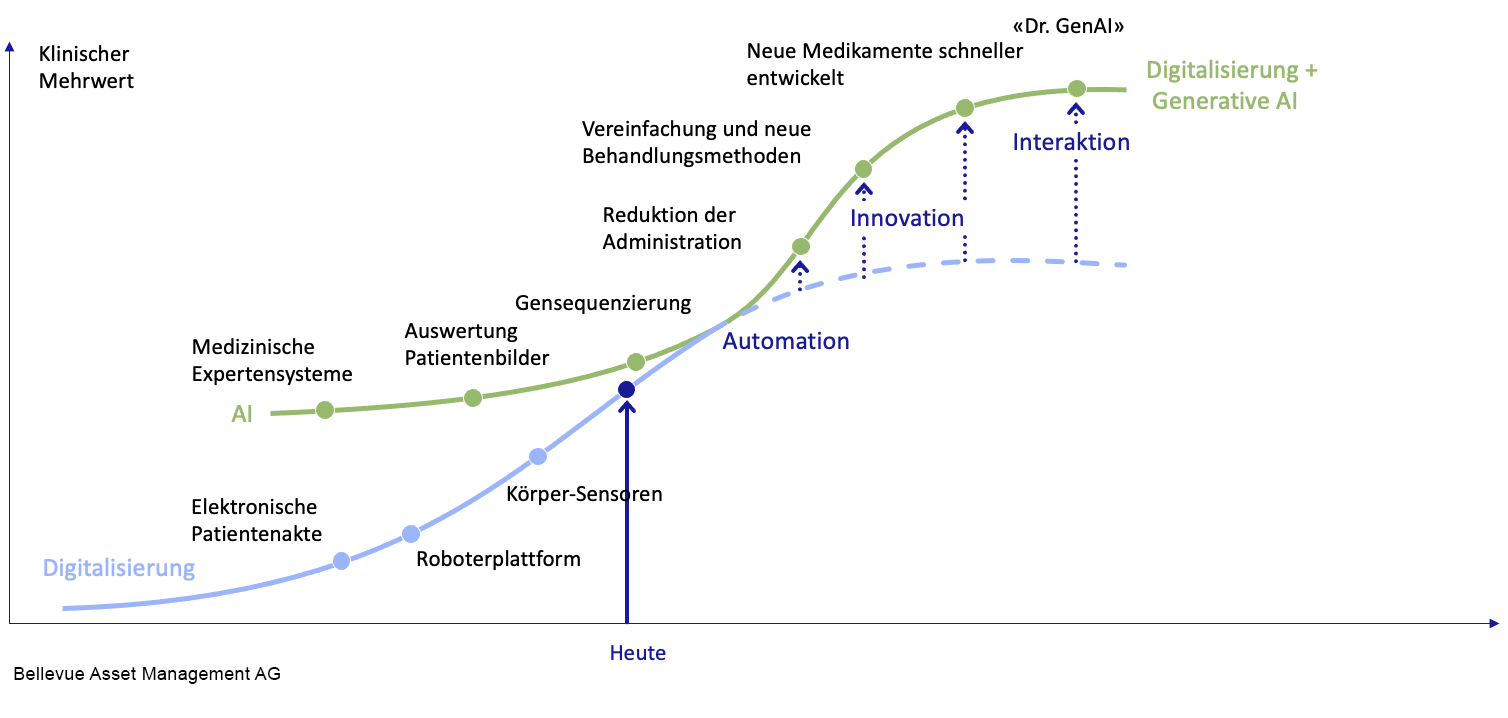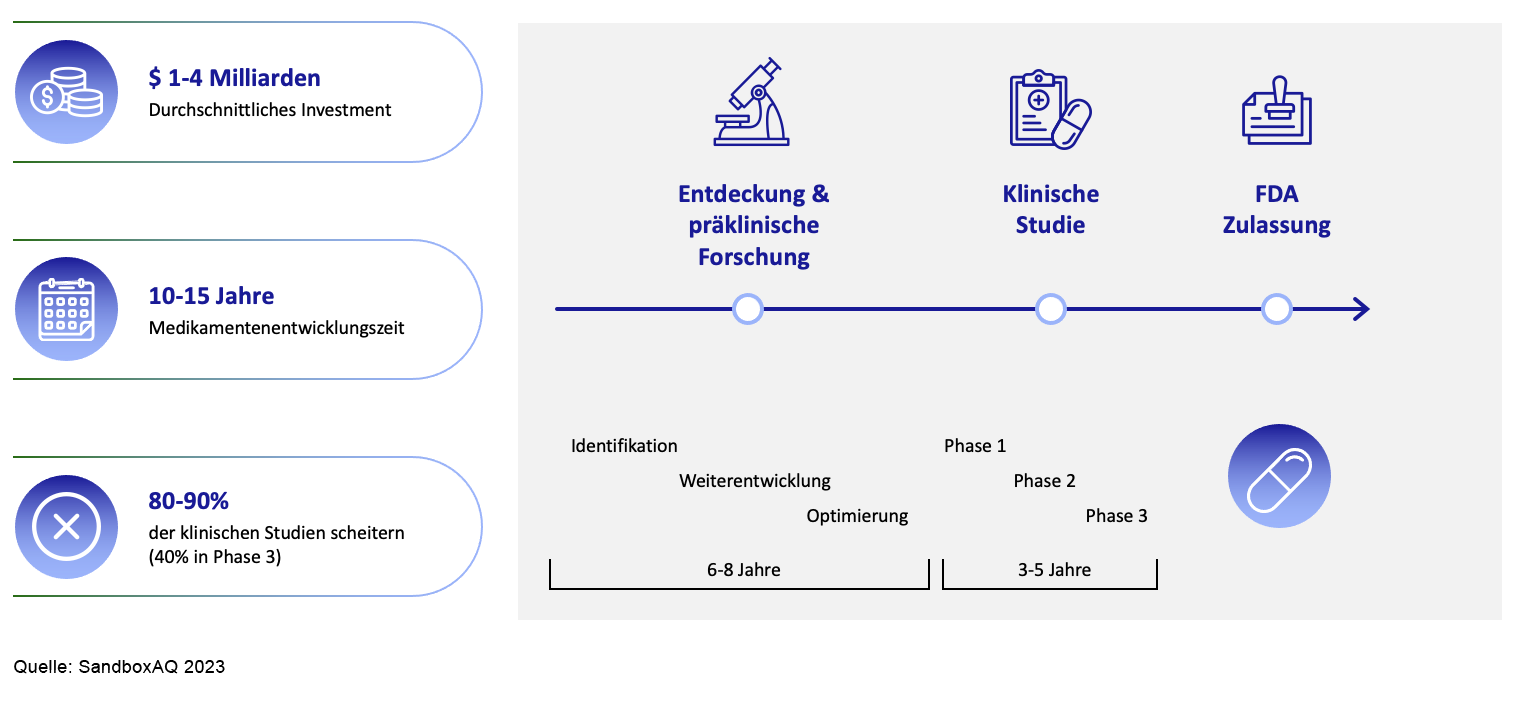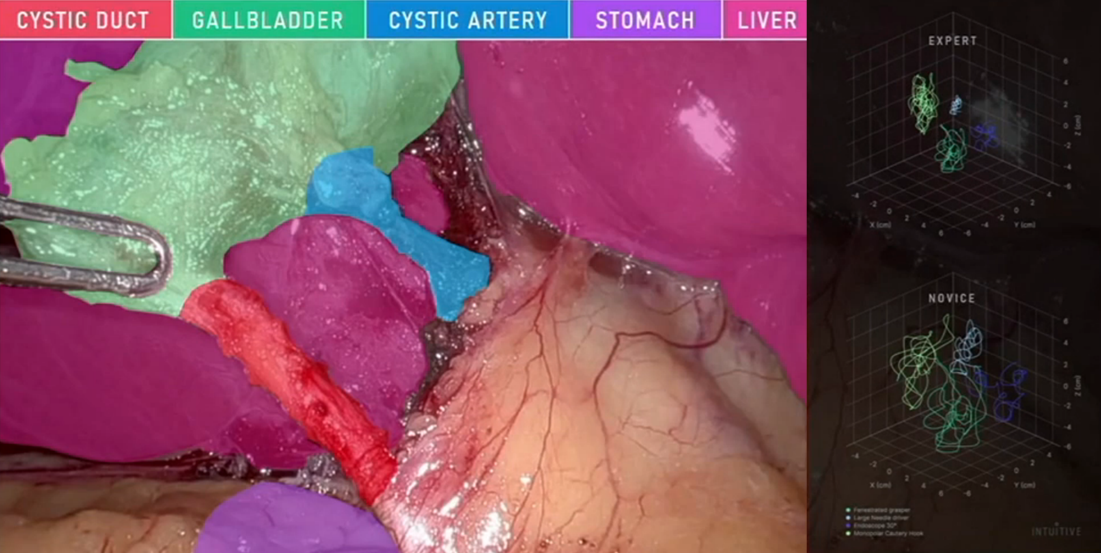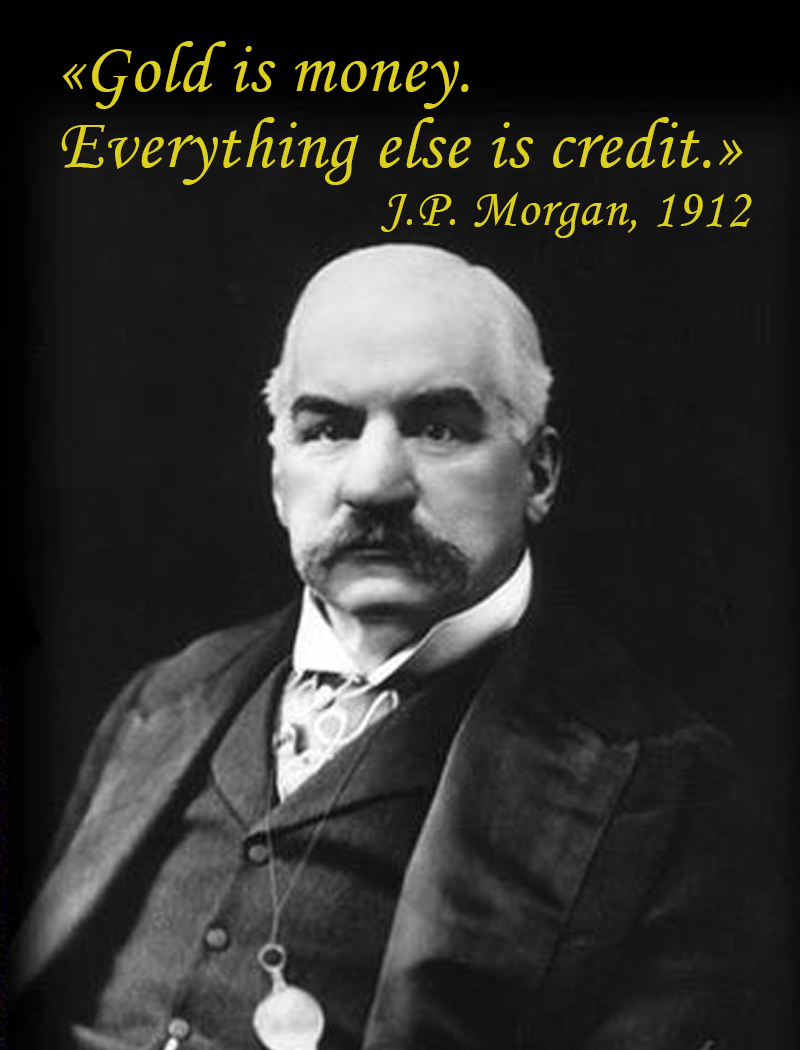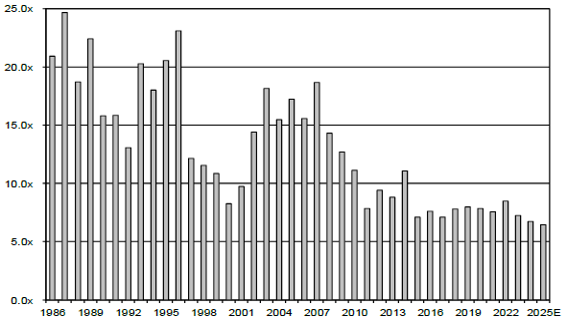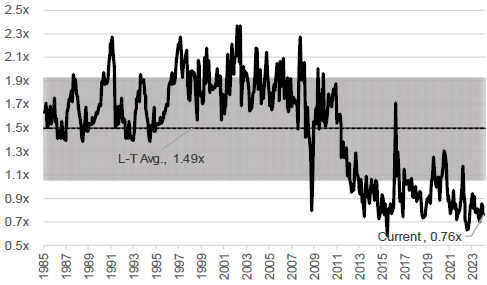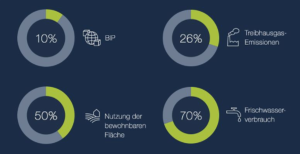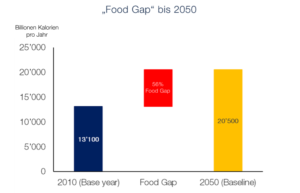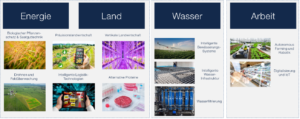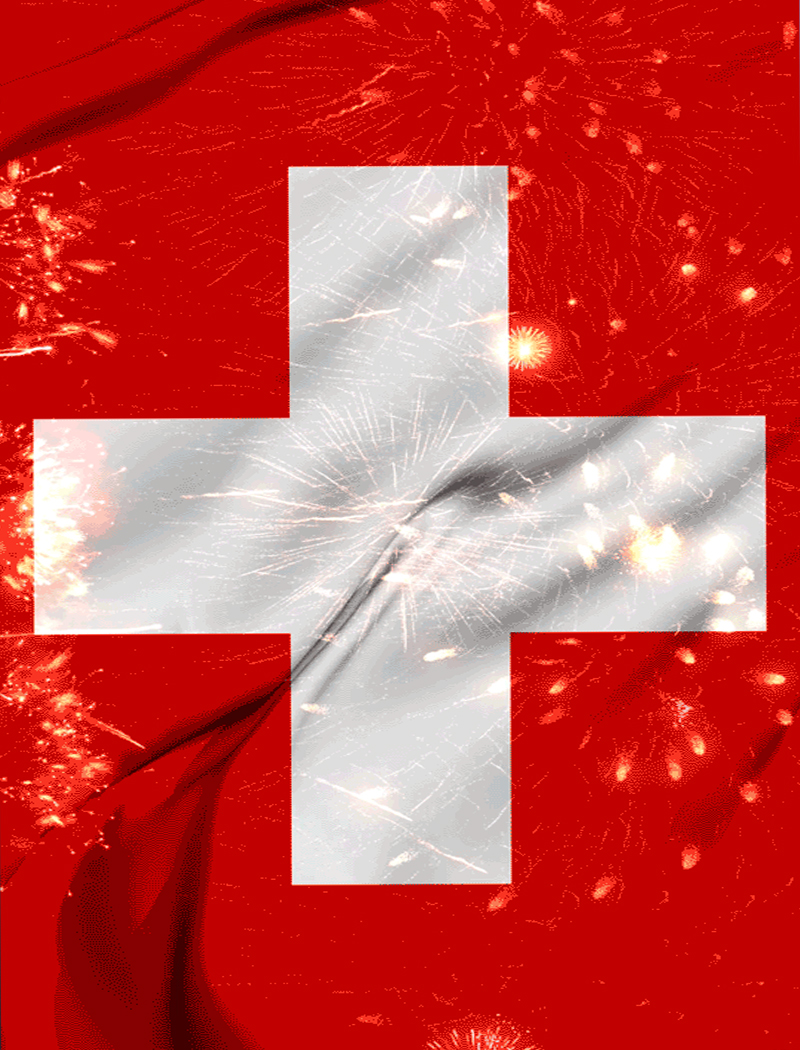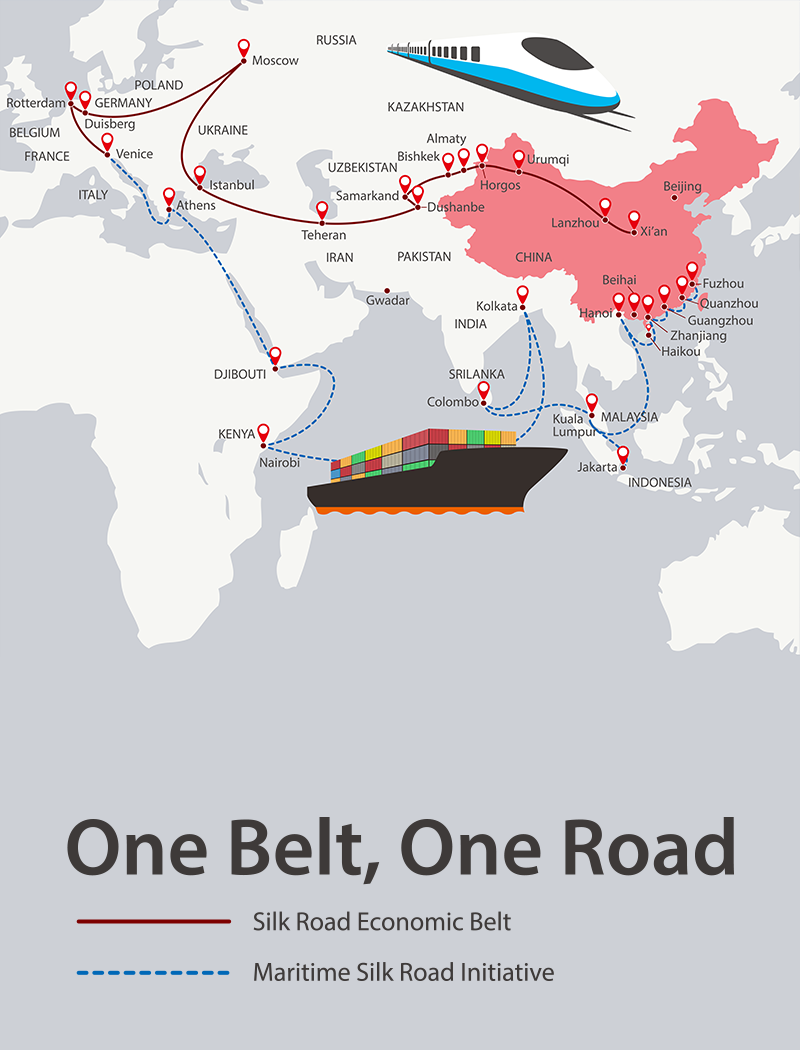Jedes Leben endet früher oder später. Sterben macht Erben oder wie die Franzosen zu sagen pflegen: «Le mort saisit le vif» – der Tote ergreift den Lebendigen. Jeder und jede wird einmal davon betroffen sein. Wer erbt und was mit den hinterlassenen Vermögenswerten geschieht, bestimmt das Gesetz. Ein künftiger Erblasser oder eine künftige Erblasserin kann jedoch mit einer Verfügung von Todes wegen davon abweichen und für seinen respektive ihren Nachlass anderslautende Regelungen treffen. Den dabei zu beachtenden Rahmen bestimmt wiederum das Gesetz.
Das geltende Schweizerische Erbrecht stammt im Wesentlichen aus dem Jahr 1912. Es ist somit über 100 Jahre alt. Das Schweizer Erbrecht soll nun schrittweise revidiert und den Anforderungen der heutigen Zeit angepasst werden. Ein erster Teil der Revision ist am 01. Januar 2023 in Kraft getreten.
Eltern haben keinen Pflichtteil mehr
Seit dem 01. Januar 2023 gehören die Eltern des Erblassers oder der Erblasserin nicht mehr zu den pflichtteilsgeschützten Erben. Sie bleiben jedoch weiterhin gesetzliche Erben, sofern der Erblasser oder die Erblasserin keine Nachkommen (Kinder, Kindeskinder, usw.) hinterlässt. Der Pflichtteilanspruch der Eltern betrug bis 31. Dezember 2022 die Hälfte des gesetzlichen Erbanspruchs.
Wenn der Erblasser oder die Erblasserin unverheiratet und ohne Nachkommen verstirbt, erben die Eltern den gesamten Nachlass, sofern keine anderslautende Verfügung besteht. An die Stelle von Vater und Mutter, die vorverstorben sind, treten deren Nachkommen, somit die Geschwister und Geschwisterkinder des Erblassers oder der Erblasserin. Fehlen auch diese gelangt die Erbschaft von Gesetzes wegen an die Grosseltern bzw. bei Vorversterben wiederum an deren Nachkommen, somit an Onkel, Tanten, Cousins, Cousinen des Erblassers oder der Erblasserin. An der bisherigen Regelung ändert die Gesetzesrevision nichts.
Neben einem Ehegatten erben die Eltern eines oder einer kinderlos Verstorbenen von Gesetzes wegen einen Viertel des Nachlasses, sofern keine anderslautende Verfügung besteht. An der bisherigen Regelung ändert die Gesetzesrevision nichts.
Neu ist, dass der Erbanspruch der Eltern durch eine Verfügung von Todes wegen, also durch ein Testament oder einen Erbvertrag, gänzlich wegbedungen und aufgehoben werden kann. In der Nachlassplanung muss somit auf den bisherigen Pflichtteilsanspruch der Eltern keine Rücksicht mehr genommen werden.
Was bedeutet das konkret?
Hinterliess der Erblasser oder die Erblasserin bis 31. Dezember 2022 weder einen Ehegatten noch Nachkommen, jedoch seine Eltern, mussten diese mit der Hälfte des Nachlasses berücksichtigt werden. Hinterliess er oder sie einen Ehegatten, mussten die Eltern immer noch mit einem Achtel seines oder ihres Nachlasses berücksichtigt werden. Seit dem 01. Januar 2023 kann der Erblasser oder die Erblasserin die Eltern vom Erbe ausschliessen und anderweitig verfügen. Es besteht kein Anfechtungsrisiko mehr.
Aber Achtung: Ohne eine Verfügung von Todes wegen gelangt das gesetzliche Erbrecht weiterhin zur Anwendung. Sollen die Eltern vom Erbe ausgeschlossen werden, muss dies mittels Testament oder Erbvertrag verfügt werden.
Reduktion der Pflichtteile für Nachkommen
Von Gesetzes wegen und ohne anderslautende Verfügung erhalten die Kinder die ganze Erbschaft zu gleichen Teilen, wenn sie nicht mit einem überlebenden Ehegatten des Verstorbenen oder der Verstorbenen zu teilen haben. Neben einem überlebenden Ehegatten und ohne anderslautende Verfügung erhalten die Kinder von Gesetzes wegen die Hälfte der Erbschaft.
Seit dem 01. Januar 2023 beträgt der Pflichtteilsanspruch der Nachkommen neu die Hälfte ihres gesetzlichen Erbanspruchs. Vor der Revision betrug dieser Pflichtteilsanspruch drei Viertel ihres gesetzlichen Erbanspruchs.
Diese Pflichtteilsreduktion ist ein zentraler Punkt der Gesetzesrevision. Sie ermöglich einen deutlich grösseren Handlungsspielraum in der Nachlassplanung. Die Reduktion der zu beachtenden Pflichtteile bewirkt, dass die frei verfügbare Quote neu mindestens die Hälfte des Nachlasses beträgt.
Pflichtteilsanspruch im Scheidungsverfahren
Die pflichtteilsgeschützte Quote des Ehepartners beziehungsweise des eingetragenen Partners bleibt von der Revision unberührt und damit unverändert bestehen. Sie beträgt weiterhin die Hälfte des gesetzlichen Erbanspruchs.
Neu erlischt aber der Pflichtteilsanspruch bereits bei einem hängigen Scheidungsverfahren oder wenn das Paar während mindestens zwei Jahren getrennt gelebt hat. Bislang war dies erst der Fall, nachdem das Paar rechtskräftig geschieden oder die eingetragene Partnerschaft aufgelöst war.
Schenkungsverbot nach Abschluss eines Erbvertrags
Durch den Abschluss eines Erbvertrags (beispielsweise unter Ehegatten und Nachkommen) können die Vertragsparteien zum Beispiel Erbverzichte und Begünstigungen vorsehen. Bis 31. Dezember 2022 konnten die Vertragsparteien trotz Abschluss eines Erbvertrags weiterhin frei über ihr ganzes Vermögen verfügen.
Diese Verfügungsfreiheit hat sich per 01. Januar 2023 zu einem eigentlichen Schenkungsverbot gewandelt: Neu sind nach Abschluss eines Erbvertrags grundsätzlich alle Schenkungen anfechtbar, sofern es sich nicht um Gelegenheitsgeschenke handelt und sofern der Erbvertrag solche Schenkungen nicht ausdrücklich zulässt.
Unveränderte Formvorschriften
Verfügungen von Todes wegen unterstehen zwingenden gesetzlichen Formvorschriften. Ein Testament muss entweder handschriftlich verfasst, datiert und unterzeichnet sein oder es muss vor einem Notar / einer Notarin und unter Mitwirkung von zwei Zeugen errichtet werden. Der Erbvertrag muss immer unter Mitwirkung von zwei Zeugen durch einen Notar / eine Notarin öffentlich beurkundet werden. Durch die Gesetzesrevision erfahren diese Formvorschriften keine Änderung.
Müssen bestehende Testamente / Erbverträge angepasst werden?
Das neue Recht kommt zur Anwendung, sofern der Erblasser oder die Erblasserin nach dem 31. Dezember 2022 verstorben ist. Das anwendbare Recht bestimmt sich einzig nach dem Todestag. Die Gesetzesrevision sieht keine Übergangsregelung vor.
Es empfiehlt sich, bereits errichtete Testamente und Erbverträge zu überprüfen und bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen. Ist in einem Testament / Erbvertrag klar geregelt, ob alt- oder neurechtliche Pflichtteilsregelunge zur Anwendung gelangen? Stimmt der Inhalt der Urkunde immer noch mit dem Willen des oder der Verfügenden (und im Hinblick auf die neuen gesetzlichen Regelungen) überein? Falls nein, sollte allenfalls eine Anpassung oder Ergänzung des Dokuments in Betracht gezogen werden.
Praxisbeispiel
Ein Ehepaar hat keine gemeinsamen Kinder. Der Ehemann hat zwei Kinder aus erster Ehe. Die Eltern der Ehefrau leben noch. Das Ehepaar möchte sich maximal begünstigen und hat bereits vor längerem letztwillig verfügt. Aufgrund der Gesetzesrevision kann die Begünstigung nun verbessert werden.
Die Ehefrau kann den Ehemann neu als Alleinerben einsetzen.
1.) Ich hebe hiermit alle bisher errichteten Testamente vollumfänglich auf.
2.) Aus meinem Nachlassvermögen sind vorweg alle offenen Verbindlichkeiten zu bezahlen sowie ein angemessener Betrag für die Beerdigung sicherzustellen.
3.) Ich setze meinen Ehemann ……………, geboren am …….., als Universalerben für meinen gesamten Nachlass ein.
4.) Sofern ich nach meinem Ehemann …………… oder gleichzeitig mit ihm versterbe, so dass er mich nicht beerben kann, soll die gesetzliche Erbfolge zum Tragen kommen.
Der Ehemann kann der Ehefrau neu drei Viertel des Nachlasses zuwenden.
1.) Ich hebe hiermit alle bisher errichteten Testamente vollumfänglich auf.
2.) Aus meinem Nachlassvermögen sind vorweg alle offenen Verbindlichkeiten zu bezahlen sowie ein angemessener Betrag für die Beerdigung sicherzustellen.
3.) Meine Kinder …………………………….., und ………………………………, setze ich auf den vom Gesetz vorgesehenen Pflichtteil. Die verfügbare Quote meines Nachlasses wende ich meiner Ehefrau ……………… zusätzlich zu ihrem gesetzlichen Erbanspruch zu. Sie erhält somit drei Viertel meines Nachlasses.
4.) Sofern ich nach meiner Ehefrau ……………… oder gleichzeitig mit ihr versterbe, so dass sie mich nicht beerben kann, soll die gesetzliche Erbfolge zum Tragen kommen.
Unternehmensnachfolge – ein Ausblick
Stand heute existiert in der Schweiz kein bürgerliches Unternehmenserbrecht, im Gegensatz zum bäuerlichen Erbrecht. Es sind jedoch gesetzliche Änderungen geplant. Der Bundesrat hat im Juni 2022 eine Botschaft zuhanden der eidgenössischen Räte verabschiedet. Was könnte künftig auf uns zukommen?
Hinterlässt der Erblasser ein Unternehmen, könnte dieses in Zukunft als Ganzes und auf Antrag einem Erben zugewiesen werden. Bis dato ist dies aufgrund der gesetzlichen Regelungen praktisch unmöglich. Als Folge davon muss die Unternehmung verkauft und der Erlös unter den Erben geteilt werden.
Wird das Unternehmen durch einen Erben übernommen, hat dieser in aller Regel Ausgleichszahlungen an die anderen Erben zu leisten. Hierfür sieht der Gesetzesentwurf einen Zahlungsaufschub vor. So würde die Übernahme einer Unternehmung faktisch überhaupt erst möglich, ohne dass der Übernehmende in erhebliche finanzielle Schwierigkeiten käme.
Schliesslich ist vorgesehen, beim Übernahmewert auf den Verkehrswert der Unternehmung im Zeitpunkt der lebzeitigen Übertragung abzustellen, und nicht mehr auf den Zeitpunkt des Erbgangs. Damit soll verhindert werden, dass der übernehmende Nachkomme einen selber erwirtschafteten unternehmerischen Gewinn nach dem Tod Erblassers oder der Erblasserin mit den übrigen Erben teilen muss. Umgekehrt müssen die übrigen Erben auch keinen Verlust mittragen.
Fazit
Die Erbrechtsrevision führt zu mehr Freiheiten in der Nachlassplanung. Mehr Freiheiten bedeuten selbstredend auch mehr Verantwortung. Von den neuen Möglichkeiten kann jedoch nur zu Lebzeiten Gebrauch gemacht werden. Es ist deshalb nie zu früh, leider aber oft zu spät, sich Gedanken über den eigenen Nachlass zu machen.
Der Autor, Simon Stemmer, ist Rechtsanwalt und Notar. Im Jahr 2011 gründete er die Kanzlei STEMMER – Advokatur & Notariat – in Liestal. Seine berufliche Laufbahn startete er beim Schweizerischen Bankverein, Basel, im Bereich Erbschaften. Es folgten Tätigkeiten als Jurist beim Bundesamt für Wohnungswesen, als langjähriger Notar und Grundbuchverwalter beim Kanton Basel-Landschaft sowie als Leiter Immobilienverträge im Stab ETH-Rat, Zürich.